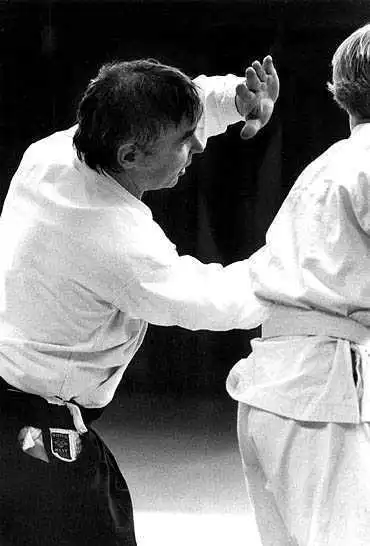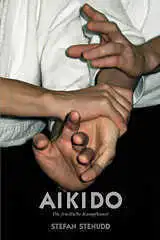Omote, ura -
Vorderseite, Rückseite

Franck Noel. Foto: Magnus Hartman.
Die meisten Aikidotechniken gibt es in zwei Versionen,
die dadurch gekennzeichnet sind, dass sie ihr Schwergewicht
entweder auf irimi oder auf tenkan legen — der Schritt hinein oder
der Schritt herum. Die Version, die auf irimi basiert, wird
hauptsächlich vor dem Angreifer ausgeführt, während die andere
Version eine Positionsveränderung um diesen herum und hinter
diesen beinhaltet. Es pflegt für Anfänger im ersten Jahr des
Aikidotrainings sehr schwer zu sein, diese zwei Versionen
unterscheiden zu können und sie mit Verständnis für ihren Unterschied
auszuführen. Selbst hatte ich in der entsprechenden Periode die
bemerkenswerte Eigenheit an mir, dass ich, selbst wenn wir in der
erstgenannten Form unterrichtet wurden, die zweite Form
ausführte, ohne es zu merken, auch wenn wir diese noch nicht geübt
hatten. Mein Lehrer zu jener Zeit, Allan Wahlberg, hatte mächtig
Spaß damit. Selbst will ich glauben, dass das darauf beruhte, dass
ich instinktiv nach der weichsten Möglichkeit suchte, dem Angriff
zu begegnen, da ich verstanden hatte, dass das der Witz mit
Aikido war, und da wurde die am meisten ausweichende Bewegung
die natürliche.
Als ich anfing, Aikido zu trainieren, war die
Terminologie begrenzt und leidlich ins Schwedische gebracht, und so
wurden die zwei Formen positiv und negativ genannt, während die
korrekte japanische Bezeichnung omote und ura ist. Im Aikido
werden diese Begriffe manchmal synonym mit irimi und
tenkan gebraucht, da sie deutlich paarweise zusammengehören,
irimi/omote und tenkan/ura, so wie es weiter oben beschrieben
wurde. Aber omote und ura sind komplexe Begriffe mit einer
Bedeutung, die sich weit über die technische Terminologie des Aikido
hinaus erstreckt.
Omote bedeutet in etwa Vorderseite oder Außenseite
und kommt ursprünglich von der Bezeichnung für die haarige
Seite eines Pelzes oder die Außenseite eines Kleidungsstücks. Es
handelt sich also um das Äußere, das Sicht- und Offenbare. Ura steht
für die entgegengesetzte Seite, Rück- und Innenseite, das
Verborgene. Ursprünglich bedeutet es Futter oder die haarlose Innenseite
des Pelzes. Dieses Wortpaar kann daher mit den Gegensätzen
offenbar und verborgen verglichen werden, oder, wenn man so
will, mit aufrichtig und ausweichend. Ich habe nie den
Eindruck bekommen, dass japanische Lehrer irgendeine moralische
Wertung dahineingelegt haben, obwohl das für uns im Westen
naheliegen würde. Eher ist mein Eindruck, dass sie das Ganze wie
die zwei Seiten einer Münze sehen, so unvermeidlich wie eben
die Tatsache, dass ein Kleidungsstück sowohl Innen- als
Außenseite hat.

Yin-yang (in-yo). Stefan Stenudd.
Im Training zieht man einen deutlichen Gewinn
daraus, wenn man versucht, sich in diese Gegensätze respektive
Charaktere einzuleben, so dass die Omoteformen einer Technik
nahezu aufdringlich durchgeführt werden können, mit der starken
Einstellung, dem Angriff möglichst schnell zu begegnen —
natürlich trotzdem mit einer weggleitenden Körperdrehung, tai sabaki,
so dass man nicht mit der Kraft des Angriffs zusammenstößt
- während ura so ausgeführt wird, dass man schon bei der
initialen Begegnung sozusagen für den Gegner verschwindet, aus
dessen Sichtfeld, und weiter weggleitet, in den Schatten hinein.
Das kann man im höchsten Grad mit den chinesischen
Gegensätzen yin und yang vergleichen, die auf japanisch in und yo heißen,
welche mit ihrer ursprünglichen Bedeutung Schattenseite und
Sonnenseite deutliche Parallelen zu ura und omote sind. Bei der
Ausführung von omote soll die Attitüde
immer mit yang vergleichbar sein, das als extrovert, hell, warm
beschrieben wird und traditionell als maskulin gilt. Die Uraversion sollte
hingegen yin gleichen, das als introvert, dunkel, kalt und traditionell
feminin gilt. Man kann an und für sich gern die Geschlechterrollen
diskutieren, die darin liegen.
Ein anderes Gegensatzpaar, das mit omote und ura
verwandt ist, ist der alte Budobegriff shoden und okuden, die vorderen
oder ersten Lehren respektive die inneren oder tiefen Lehren.
Einige Budostile legten großen Wert darauf, ihre Kunst auf diese
Weise aufzuteilen, wobei ein Anfänger lange und gut shoden
üben musste, bevor er als reif angesehen wurde, in okuden
eingeweiht zu werden — für einige wurde das nie aktuell. In gewissen
Iaidostilen zum Beispiel gibt es immer noch eine solche
Aufteilung, aber inzwischen gibt es keine Restriktionen, die einen
Anfänger davon abhalten können, beide Arten zu trainieren.
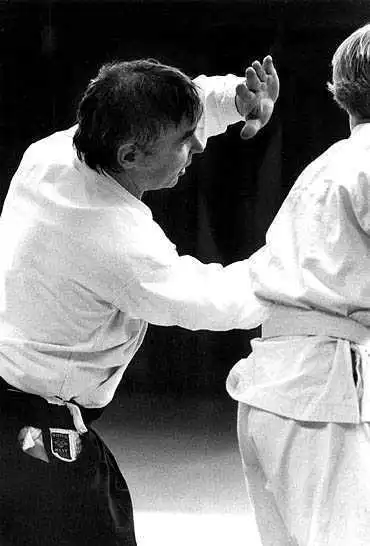
Hans Gauffin. Foto: Magnus Hartmann.
Im Aikido gibt es keine Aufteilung in shoden und
okuden, ich glaube, der Gedanke wäre sehr fremd für osensei — auch
wenn er ein klein wenig zurückhaltend damit war, andere als seine
Lehrer in Kontertechniken, kaeshiwaza, zu unterweisen.
Ebensowenig hatte Miyamoto Musashi, der legendäre Samurai, der im
17.Jahrhundert lebte und das immer noch vielgelesene "Buch der
fünf Ringe" schrieb, irgendwelchen Respekt vor dieser Aufteilung.
Er erklärt kategorisch, dass es "im wirklichen Kampf nichts
derartiges gibt, wie mit einer äußeren Technik zu schlagen und mit
einer inneren Technik zu hauen". Er gibt gewiss zu, dass es
einfachere und tiefere Dinge innerhalb der Kampfkünste gibt, welche
die Schüler sich während ihrer Entwicklung mit
unterschiedlicher Leichtigkeit aneignen können, aber er behauptet mit
Bestimmtheit, dass es nicht geht, die Techniken danach zu sortieren.
Inneres und Äußeres gehen unausweichlich ineinander auf:
"wenn man tiefer und tiefer in den Berg eindringt, wird man sich mit
der Zeit wieder an einem Eingang befinden."
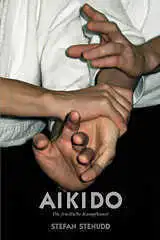
Aikido — die friedliche Kampfkunst
Stefan Stenudds Einführung in die Grundprinzipien von Aikido gibt es jetzt auch als Printausgabe, mit überarbeitetem Text und zahlreichen neuen Fotos.
Hier geht's zum Buch auf Amazon.
AIKIDO — die friedliche Kampfkunst
Stefan Stenudd
Übersetzung: Sabine Neumann
© Stefan Stenudd 2006. Arriba Verlag.
Dank an Norbert Lender für das eBook.

Aikido Menu
AIKIDO PRACTICE
AIKIDO THEORY
My Other Websites
Myths in general and myths of creation in particular.
The wisdom of Taoism and the
Tao Te Ching, its ancient source.
An encyclopedia of life energy concepts around the world.
Qi (also spelled
chi or
ki) explained, with exercises to increase it.
The ancient Chinese system of divination and free online reading.
Tarot card meanings in divination and a free online spread.
The complete horoscope chart and how to read it.

Stefan Stenudd
About me
I'm a Swedish author of fiction and non-fiction books in both English and Swedish. I'm also an artist, a historian of ideas, and a 7 dan Aikikai Shihan aikido instructor. Click the header to read my full bio.